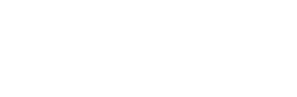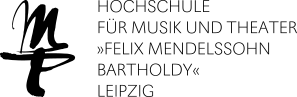enlarge image
enlarge image
 minimize image
minimize image

Projektphase 1 2017-2020: Entwicklungen seit den 1960er Jahren
Projektphase 2 seit 2021: Häuser und Orte künstlerisch-kultureller
Mischnutzungen - Zugänglichkeit, Programmierung und erweiterte Szenografien
Zieht man als Orte und Räume für die Aufführungskünste nicht allein die im engen Sinne für Theater / Tanz / Performance gebauten Architekturen in Betracht, so lassen sich die Ergebnisse der ersten Phase des Forschungsprojektes in eine umfassendere Entwicklung einbetten. Auf zunächst vier verschiedenen Ebenen lässt sich eine Öffnung der mono-künstlerisch ausgerichteten Bauten und Programme von Theatern, Opern, Ausstellungshäusern / Museen beobachten. Diese vier Ebenen repräsentieren unterschiedliche Konstellationen zwischen kulturellen Institutionen und deren Architekturen, (Stadt)Gesellschaft und Nutzer:innengruppen:
— Kulturelle Mischnutzung (oder: Vernetzung verschiedener kultureller/ künstlerischer Nutzungen) meint die räumliche Nähe und geteilte Architektur verschiedener, bis vor kurzem getrennt untergebrachter, kultureller und kunstbezogener Orte und Institutionen.
— Öffnung der mono-künstlerisch ausgerichteten Orte und Häuser findet man in verschiedenen Facetten. Die Theater(gebäude) z.B. sollen sich für die Stadtgesellschaft und die Nachbarschaften der Orte, an denen sie sich befinden, öffnen. Diese Diskussion führt zu den Debatten um „city as commons“ (Stavrides 2016) oder „porous city“ (Wolfrum u.a. 2018), für die gemeinsame, einladende und zugängliche (Schwellen)Räume ein wesentlicher Aspekt von zukünftiger Urbanität sind.
— Vernetzung kultureller Nutzungen als Notwendigkeit für die ländliche Infrastruktur
In ländlichen Regionen zeigt sich eine Vielfalt von Häusern, Orten und Räumen, die sowohl privat initiiert wie öffentlich gefördert werden. Ihre Programmierung ist sehr unterschiedlich, ihre baulich-architektonischen ‚Hüllen‘ sehr verschieden.
— Konversions-Areale und -Ensembles als Rahmen für Vernetzung kultureller Nutzungen
Die kulturell-künstlerische Umnutzung ehemaliger Industrieanlagen und -gebäude, die sich auf einem weitläufigen Gelände befinden, implizieren bereits als Areal eine Vernetzung kultureller Nutzungen. Die daraus entstehenden Synergien im Sinne einer Öffnung und Zugänglichkeit für die unterschiedlichsten Nutzer:innen-Gruppen, aber auch die bauliche Ausrichtung der verschiedenen Gebäude auf dem Gelände, die Gestaltung ihrer Schwellen zueinander, die gemeinsamen Plätze und verbindenden Wege und Räume werden als Formen von Zugänglichkeit und Schwellenräumlichkeit untersucht.
Mit dieser Kontextualisierung und erweiterten Fragestellungen werden die Ergebnisse zu Räumen und Architekturen der Aufführungskünste in aktuelle, internationale Diskurse zur Zukunft der Stadt/ der Region und ihrer kulturell-künstlerischen Orte, Räume und Häuser eingebettet. Und die Untersuchung referiert auf diese Weise auf Entwicklungen in der Aufführungspraxis solcher Häuser, wie sie sich in verschiedenen kulturellen und regionalen Konstellationen zeigen.
Transdisziplinäres Forschungsprojekt zwischen Theater- und Medienwissenschaft und Architekturgeschichte und -theorie
Gefördert von der Deutschen Forschungsgemeinschaft
Leitung:
Prof. Dr. habil. Barbara Büscher, Hochschule für Musik und Theater Leipzig,
Prof. Dr. Annette Menting, Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig
Wissenschaftliche Mitarbeiterin: Verena Elisabet Eitel, Dipl. Dramaturgin
Studentischer Mitarbeiter: Tobias Fabek
Kooperationspartner:innen:
Prof. Dr. Nathalie Bredella, Professur Architektur-, Medien- und Gendertheorie, Universität der Künste Berlin
Prof. Melanie Humann, Urbanismus und Entwerfen, Technische Universität Dresden
Prof. Dr. Carolin Höfler, Designtheorie und -forschung, Technische Hochschule Köln
Prof. Dr. Jan Lazardzig, Institut für Theaterwissenschaft, Freie Universität Berlin
Prof. Dr. Hans-Rudolf Meier, Professur Denkmalpflege und Baugeschichte, Bauhaus-Universität Weimar
Dr. Terezie Petiskova, künstlerische Leiterin, House of Arts Brno
Prof. Dr. Kati Röttger, Theaterwissenschaft, Universität Amsterdam
Prof. Dr. Christina Thurner, Theater- und Tanzwissenschaftlerin, Universität Bern
Informationen zu "Architektur und Raum für der Aufführungskünste" auf den Internetseiten der DFG.
Informationen zu "Architektur und Raum für die Aufführungskünste" auf der Seite der Fachrichtung Dramaturgie.
Projekt-Website: http://auffuehrungarchitekturraum.net/
Barbara Büscher/ Verena Elisabet Eitel (Hg.):
HELLERAU - Europäisches Zentrum der Künste Dresden. Geschichte, Raumprogramm, kuratorische Konzeptionen und künstlerische Projekte. Leipzig 2023Arbeitsheft #4: Produktionhäuser zeitgenössischer performativer Künste
Siehe: http://www.perfomap.de/arbeitshefte
(Freier Download)
Annette Menting
Topologie Chemnitz. Spielstätten im Stadtkontext. Leipzig 2021
Arbeitsheft #3: Urbane Topologien und Orte für die Aufführungskünste
Siehe: http://www.perfomap.de/arbeitshefte(Freier Download)
Barbara Büscher/ Verena Elisabet Eitel:
PACT Zollverein Essen. Geschichte, Raumprogramm, kuratorische
Konzeptionen und künstlerische Konzepte. Leipzig 2021
Arbeitsheft #2: Produktionhäuser zeitgenössischer performativer Künste
Siehe: http://www.perfomap.de/arbeitshefte
(Freier Download)
Barbara Büscher/ Verena Elisabet Eitel:
Forum Freies Theater Düsseldorf. Geschichte, Raumprogramm,
kuratorische Konzeptionen und künstlerische Konzepte. Leipzig 2020
Arbeitsheft #1: Produktionshäuser zeitgenössischer performativer Künste
(Freier Download)»Temporäre Orte«: Mit Beiträgen von Barbara Büscher,
Marie-Therese Bruglacher / Verena E. Eitel, Thomas Hirschhorn /
Les Laboratoires d'Aubervilliers, Felix Kubin / Burkhard Friedrich.
Siehe: http://www.perfomap.de/map11
Mit Beiträgen von Amelie Deuflhard, Verena E. Eitel, B. Foerster-Baldenius/
C. Gurk/ P. Oswalt/ M.Rick, Carolin Höfler, Annette Kisling, Jan Lazardzig,
Lukasz Lendzinski/ Peter Weigand, Jan Lemitz/ Kathrin Tiedemann,
Hans Rudolf Meier, Britta Peters/ Dirk Baumann, Juliane Richter, Julia Schäfer,
Christian Teckert, Christina Thurner, Demian Wohler, Andreas Wolf,
Barbara Büscher & Annette Menting.
Panel mit Verena Elisabet Eitel, Nadine Kesting-Jiménez, Jochen Lamb,
Franziska Ritter, Halvard Schommartz und Marie-Charlott Schube
Moderation: Jan Lazardzig
Zahlreiche Theaterbauten werden im deutschsprachigen Raum derzeit als
matter of urgency kontrovers diskutiert. Dabei stellt sich zum einen die Frage,
wie mit dem sanierungsbedürftigen Theaterbauerbe in Bezug auf Funktionalität,
Nachhaltigkeit und Denkmalschutz umzugehen ist. Zum anderen steht – ver-
mittels von Spielort und Architektur – die Frage nach der Relevanz von Theater
für eine demokratische Gesellschaft im Raum. Trotz einer Virulenz raum-
theoretischer Fragen, sind Fragen der gesellschaftlichen Funktion von Theater-
architektur und Spielraumgestaltung – nicht zuletzt, da sie gewissermaßen im
Zwischenbereich von architektur-, theater- und kunstwissenschaftlichen
Expertisen anzusiedeln sind – innerhalb der Theaterwissenschaft in den letzten
Dekaden kaum adressiert worden.
Mit einem kuratierten Panel oder Forum möchten wir dazu einladen, gemeinsam
den Ort (im doppelten Sinne) von Theaterarchitektur zu diskutieren:
Wie bestimmen historische Wissensbestände und ihre Ausdifferenzierung die
wissensgeschichtliche Konstruktion von Theaterbau? Welche anderen
Aufführungsarchitekturen kommen als Orte und Räume performativer Praxis und
Theater in den Blick?
Mehr Informationen siehe:
Theaterarchitektur: Bau, Diskurs und performative Praxis –
Auditorium in der Herfurth’schen Villa,
Galerie für Zeitgenössische Kunst Leipzig, Karl-Tauchnitz-Straße 9 – 11
Mit dem Schwerpunkt Urbane Praxis. Neue Kontexte für kulturelle Infrastruktur
möchten wir das Verhältnis von künstlerischer, forschender und planerischer
Praxis im urbanen Raum zum Thema machen. Wir sehen es in enger Verbin-
dung und als kontextuelle Rahmung unseres aktuellen Forschungsfeldes,
der Untersuchung von Häusern und Orten künstlerisch-kultureller Mischnutzun-
gen, deren Zugänglichkeit, Programmierung sowie erweiterte Szenografien.
Umnutzungen, Interventionen und Aneignungen von städtischen Orten und
Räumen zielen oftmals auf die Aktualisierung und Entwicklung von kultureller
Infrastruktur. Die Überschreibung vergangener Nutzungen und Gebrauchs-
weisen impliziert dabei die Aktivierung und Einbindung von städtischem Wissen
u.a. über deren verschiedene historische Schichten.
Mit Beiträgen von: Jochen Becker und Adam Page, Dirk Dobiéy, Agnes Förster,
Barbara Holub und Paul Rajakovics, Mandy Knospe, Julia Kurz, Leona Lynen,
Tobias Maisch, Marianna Liosi, Isis Rampf, Pablo Santacana López,
Marie-Charlott Schube
Ausführliches Programm siehe:
Wie lassen sich künstlerische und kuratorische Strategien entwickeln, die die
(Stadt)Gesellschaft in neuer Weise involvieren? Welche neuen Praktiken können
die monokünstlerisch ausgerichteten Häuser für den Prozess des Über-
schreitens von Spartengrenzen und institutionellen Festschreibungen öffnen?
Wie können sie sich in und mit der Stadt bewegen?
Wie können Entscheidungen und Verantwortung neu und anders geteilt werden?
Wie und wo werden Formen der Zusammenarbeit erprobt, welche die Künste
genauso umfassen wie andere Wissensfelder und stadtgesellschaftliche
Anliegen?
Wie finden urbane Kulturinstitutionen und selbstkonstituierte Räume ebenso wie
Initiativen jenseits der städtischen Zentren in Kommunikation mit Akteur:innen
neue Programmatiken und Formen der Zusammenarbeit?
Mit Beiträgen von:
Athena Athanasiou, Regina Bittner, Giovanna Bolliger, Tomas Schweigen &
Stephan Weber, Naomi Bueno de Mesquita, Barbara Büscher, Iris Dressler,
Olivia Ebert & Martin Valdés-Stauber, Katalin Erdödi, Isabel Maria Finkenberger,
Ludwig Haugk & Christine Leyerle, Kira Kirsch, Megha Kono-Patel,
Elke Krasny, Britta Peters, Sarah Reimann, Julia Schäfer, Kathrin Tiedemann,
Margarita Tsomou, Françoise Vergès, Noa Winter
In Kooperation mit Galerie für zeitgenössische Kunst Leipzig, brut Wien und
Schauspielhaus Wien
→ Siehe Abstracts und Bios (Leipzig und Wien)
Barbara Büscher, Verena Elisabet Eitel, Jan Lazardzig, Marie-Charlott Schube,
Bri Newesely
Eine Vielzahl deutscher Theaterbauten und deren Träger stehen vor der
Notwendigkeit einer Re-Konstruktion bzw. diverser Umbau- und Erhaltungs-
arbeiten. Über die Perspektivierung dieser Architekturen, ihre historische
Grundlegung und der damit verbundenen Funktionen für jeweils historische
gesellschaftliche Konstellationen sowie den Möglichkeiten zeitgenössischer
Aneignung wird jedoch kaum öffentlich nachgedacht und debattiert.
Bei diesen Fragen spielen sowohl die innere Raumanordnung wie auch die
Platzierung des Gebäudes im Stadtraum sowie seine repräsentative
Funktion durch die Gestaltung des Baukörpers und seiner Außenansicht
eine Rolle.
Zwischen dem Charakter als Monument einer historisch begründeten
Praxis und Beweglichkeit als Anforderung an einen immer wieder aktualisie-
rten Zugang zu ihr möchten wir nach den Bedingungen aktueller Architekturen
für Theater fragen.
Mit: Prof. Dr. Barbara Büscher und Verena Elisabet Eitel (HMT Leipzig),
Madhusree Dutta (Akademie der Künste der Welt),
Bettina Masuch (tanzhaus nrw), Stefanie Klingemann
u.a. sowie den Initiatorinnen
Kölner KünstlerInnen, ArchitektInnen und Kulturschaffende bauen das
PALAIS TEMPORÄR. Ein Ort von dem Impulse ausgehen, wo Interessen
verknüpft werden und der als ongoing Labor und mobiles Zentrum für
Schnittstellen zwischen den Künsten fungiert. Am 11. September 2018
ist eine erste Version auf dem Rudolfplatz erlebbar.
Teil 1 ab 15 Uhr:
TRY&SUCEED – 400 Füße, 400 Augen, 400 Hände tragen die Hülle des
Palastes. Werde Teil von PALAIS TEMPORÄR am RUDOLFPLATZ.
Teil 2 ab 18 Uhr:
DURATIONAL TALKS – Offene Diskussion mit Impulsvorträgen
Dynamisierung von Räumen und Orten.
Mobilität und Beweglichkeit als Kontexte von Bauen, Aufführen, Präsentieren.
Modellieren und Entwerfen als/im Prozess.
Aneignung von Orten und Bauten durch Transformationen.
Mit Beiträgen von: Regina Bittner, Barbara Büscher, Amelie Deuflhard,
Verena E. Eitel, Dirk Förster, Thomas Frank, Romy Heiland, Carolin Höfler,
Vera Lauf, Jan Lazardzig, Lukasz Lendzinski, Hans-Rudolf Meier,
Annette Menting, Sabine Pollak, Christoph Rech, Juliane Richter, Julia Schäfer,
Kathrin Tiedemann, Christina Thurner, Peter Weigand, Demian Wohler,
Ingo Andreas Wolf, Sabine Zentgraf, Franciska Zólyom.
Vom 18.-20.01.2018 bewegt sich die Tagung an drei Orte in Leipzig.
Hierzu kooperiert das DFG-Forschungsprojekt „Architektur und Raum für die
Aufführungskünste“ mit der Galerie für Zeitgenössische Kunst Leipzig,
der Residenz Schauspiel Leipzig, der Hochschule für Musik und Theater Leipzig
und der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig.
18.01.2018 | Auditorium GfZK-Villa | Galerie für Zeitgenössische Kunst Leipzig,
Karl-Tauchnitz-Straße 9-11, 04107 Leipzig
19.01.2018 | Club Architekturetage HTWK | Lipsius-Bau der HTWK Leipzig,
Karl-Liebknecht-Straße 145, 04277 Leipzig
20.01.2018 | Residenz Schauspiel in der Baumwollspinnerei |
Baumwollspinnerei, Halle 18, Spinnereistraße 7, 04179 Leipzig
Das ausführliche Programm finden Sie hier.
Programm_BeweglicheArchitekturen.pdf [1.4MB/pdf]
Dienstag, den 5. Dezember 2017, 15-19 Uhr, HMT Dittrichring 21, Raum 4.16